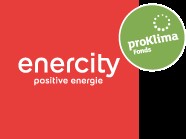Seit 2022 besteht eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen unserem Wahlpflichtkurs „Kunst und Politik“ des 11. Jahrgangs und den Hannah-Arendt-Tagen der Landeshauptstadt Hannover.
Die Schüler*innen dieses Kurses nehmen jährlich an den Veranstaltungen der Hannah-Arendt-Tage teil und begleiten die Reihe auch medial in eigener Redaktion. So entstehen Interviews, Berichte und kreative Beiträge, die auf dem schuleigenen Blog „Yellowpost“ und über unsere Social-Media-Kanäle veröffentlicht werden. Jedes Jahr setzen sich die Jugendlichen intensiv mit dem jeweiligen Schwerpunktthema auseinander – etwa Demokratie und Menschenrechte (2023) oder Freiheit (2024) – und bringen ihre Perspektiven in die öffentliche Diskussion ein. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Lernen über den Klassenraum hinaus stattfinden kann, und bereichert die Hannah-Arendt-Tage um eine junge, engagierte Stimme.
Unsere Schülerinnen Franziska, Amira und der Schüler Clemens haben Oberbürgermeister Belit Onay im Neuen Rathaus getroffen – zum Gespräch über ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: Macht und Gewalt.

Warum wurde genau dieses Spannungsfeld zum Leitmotiv der Hannah-Arendt-Tage 2025? Wie erleben wir Gewalt im Alltag – verbal, institutionell, rassistisch? Und was schützt unsere Demokratie, wenn sie ins Wanken gerät? Ein Gespräch über politische Verantwortung, verletzliche Freiheit und den Wert einer freien Presse.
Franziska, Clemens und Amira: Wir wollen uns bedanken, dass wir hier sein dürfen und dass wir mit Ihnen ein Interview führen können, und würden gleich mit der ersten Frage starten. Warum haben Sie sich für das Thema der diesjährigen Hannah-Arendt-Tage „Macht versus Gewalt“ entschieden?
Wir versuchen immer, bei den Hannah-Arendt-Tagen Themen zu setzen, die einen aktuellen Bezug haben, aber auch Hannah Arendts Perspektive widerspiegeln. Arendts Studie „Macht und Gewalt“ erschien vor 55 Jahren. Die derzeitige Situation vieler Gesellschaften, in denen Machtmissbrauch und Formen von politischer und kommunikativer Gewalt zunehmen, zeigt, dass wir mit Fragen nach den Folgen einer aus der Balance geratenen Macht Aspekte von großer Aktualität aufgreifen. Das zeigt auch der Blick in die Nachrichten. Wir haben, glaube ich, einen Weitblick bewiesen, dieses Thema für die diesjährigen Hannah-Arendt-Tage zu setzen.
Wie definieren Sie Macht? Was ist für Sie Macht im politischen oder im gesellschaftlichen Kontext?
In einer Demokratie ist Macht durch freie Wahlen legitimiert, und sie ist zeitlich begrenzt. So gibt es Wahlen, wie zum Beispiel die Bundestagswahlen, die eine Machtoption des Volkes als Souverän an die gewählten Vertreterinnen und Vertreter abgeben, die daraus mit dieser Macht Gestaltungshoheit haben. Wir sehen, dass es in einer Demokratie eine Balance gibt zwischen den unterschiedlichen Gewalten, die in einer Gewaltenteilung ausbalanciert sind, sich gegenseitig kontrollieren. Bei den Checks and Balances der USA, die ihr sicherlich auch kennt, sehen wir aber, wie das gerade an vielen Stellen ausgehebelt wird, zum Beispiel durch den US-Präsidenten. Ich glaube, Macht muss in Verbindung mit der Ausführung von Gewalt – nicht Gewalt im Sinne von tatsächlicher Gewalt, sondern der exekutiven Staatsgewalt – in einer Balance gehalten werden. Das ist mein Verständnis von demokratischen Strukturen. Wenn das funktioniert, gibt es eine wahre und gesunde Demokratie.
Haben Sie in Ihrer politischen Arbeit Erfahrungen mit subtiler oder offener Gewalt gemacht, verbal, institutionell oder digital?
Gewalt, Anfeindungen, Beleidigungen sind leider für viele Menschen, die Politik machen, im Rat, als Ehrenamtliche bis hin zum Bundeskanzler, und für viele politische Aktive in verschiedensten Initiativen, wie der Flüchtlingshilfe, des Klimaschutzes oder in anderen Initiativen, Realität. Auch für mich. Ich habe seit meiner Wahl viel rassistische Gewalt mitbekommen. Wir hatten Schmierereien vor Kurzem am Rathaus. Das waren Graffitis mit Beleidigungen, rassistischen Beleidigungen gegen mich, und auch im Internet findet diese Art der verbalen Gewalt gegen mich statt. Wir bekommen Zuschriften mit beleidigendem Inhalt, die wir an die Polizei geben, an den Staatsschutz. Leider ist dies für viele Menschen, und eben auch für mich, eine Realität.
Hat politische Gewalt Ihrer Wahrnehmung nach in den letzten Jahren zugenommen? Und woran machen Sie diese Entwicklung erkenntlich?
Es gibt Studien und auch polizeiliche Kriminalstatistiken, die politische Gewalt dokumentieren. Insbesondere rechte Gewalt hat extrem zugenommen in den letzten Jahren und Monaten. Das ist, glaube ich, für viele Menschen spürbar. Und das ist im politischen Spektrum ein Thema – für Betroffene, die politisch aktiv sind, aber auch für viele Menschen, die in den verschiedensten Orten, Initiativen, Städten, Gemeinden aktiv, aber keine öffentlichen Personen sind, die aber auch solche Gewalt erfahren. Es gab zum Beispiel beim Christopher-Street-Day in Hannover vor zwei Jahren gewalttätige Vorfälle. Auch in vielen anderen Städten werden solche Demonstrationen für Vielfalt, für solidarisches Zusammenleben angegriffen. Es gibt sehr aggressive, gewalttätige Gegendemonstrationen oder Aktionen. In Brandenburg wurde ein Fest der Vielfalt überfallen. Leider ist das offensichtlich Teil der Strategie der Rechten.
Um auf die Macht zurückzukommen, wie kann man Ihrer Meinung nach politischem Machtmissbrauch und auch Gewalt entgegenwirken?
Das beste System in der demokratischen Theorie, das habe ich vorhin beschrieben, ist die Ausbalancierung von Macht durch Legitimation, durch Begrenzung, sowohl zeitlich als auch in den Umfängen. Das geschieht durch die Gewaltenteilung, durch die verschiedensten Institutionen, die sich ein Stück weit ausbalancieren, sich gegenseitig begrenzen, und die verfassungsrechtlichen Grenzen des Grundgesetzes. Das ist der Schutzschild, der die Menschen vor dem Staat schützt gegen Übergriffigkeiten des Staates, der zugleich aber auch Rechtsverletzungen ahndet und einschränkt. Und ich glaube, dass das Entscheidende das Ausbalancieren ist und dass dies auch funktionsfähig gehalten werden muss. Die USA zeigen, dass rechtskräftige Urteile nicht akzeptiert werden. Bei der Migrationspolitik von US-Präsident Trump gab es Fälle, wo Urteile sehr klar Grenzen aufgezeigt haben, die Regierung sich darüber aber hinweggesetzt und die Justiz, die Exekutive, die Polizei, das Militär dafür missbraucht hat. Und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht für eine Demokratie, weil damit das Gesamtgefüge ins Wanken gerät und zusammenbrechen kann. Wir brauchen aber auch eine Stärkung der politischen Bildung, um demokratische Werte wie Gleichberechtigung, Menschenrechte, Respekt vor Vielfalt und Anderssein breit zu verankern.
Welche Auswirkung hat Ihrer Einschätzung nach die sogenannte vierte Gewalt auf die Gesellschaft?
Die Medien sind von sehr großer Bedeutung, weil sie eine Kontrollfunktion haben. Sie sind durch die Pressefreiheit beschrieben, das offene Wort. Und wir sehen, dass Staaten, Politiker*innen, die autokratisch sind oder auf dem Weg, Autokratien aufzubauen, die Medien diffamieren, teilweise beschädigen, Menschen inhaftieren, unabhängigen Journalismus und freie Presse damit unmöglich machen. Das ist der erste Schritt, eine starke Autokratie aufzubauen – über die Beschädigung der Presse oder den Medien den Stecker zu ziehen. Danach folgt meist der Angriff auf die unabhängige Justiz. Und daraus wird, glaube ich, sehr deutlich, dass eine freie Presse, die einen kritischen Blick auf Politik, auf politisches Handeln, auf Machtmissbrauch hat, sehr entscheidend ist.
Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach gezielte Desinformation bei der Ausübung von Macht und Gewalt? Und wie lässt sich diesem Problem begegnen?
Die Medien sind unter Druck. Das merkt man auch in Deutschland. Auch international ist das in vielen anderen Ländern so. In den sozialen Netzwerken gibt es eine große Desinformationswelle, eine Flut an Fake News, die teilweise politisch gesteuert sind. Wir merken das am Beispiel Russlands mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine, wie auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, versucht wird, falsche Informationen zu streuen, dadurch eine Meinung und Unmut zu erzeugen. Das versuchen die Rechten sehr organisiert gegenüber Minderheiten, gegenüber geflüchteten Menschen. Wir merken es in den kriegerischen Auseinandersetzungen mit Blick auf Iran, Israel, dass versucht wird, eine Deutungshoheit zu erlangen durch falsche Informationen. Da sind Informationen, die qualitativ hochwertig recherchiert und entsprechend in den Medien aufbereitet sind, von großer Bedeutung. Und nicht umsonst ist es, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar, dass Populisten und autokratische Strukturen versuchen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diskreditieren oder anzugreifen und ihm die finanzielle Grundlage und inhaltliche Unabhängigkeit durch die Infragestellung der Gebühreneinnahmen zu entziehen. Eine freie Presse ist der größte Feind einer autokratischen Struktur.
Ergreifen Sie Maßnahmen zur Förderung der Medienbildung junger Menschen? Und wenn ja, welche sind das konkret?
Wir haben unterschiedliche Bildungsangebote, Kooperationsangebote, zum Beispiel im ZeitZentrum Zivilcourage. Das Spannende ist: Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber es gibt vergleichbare Entwicklungen. Die Entwicklung von Medien, von Staaten, von Gesellschaften hängt sehr stark zusammen. Wenn man das auf die Frage der NS-Zeit übersetzt, ist die Zeit, die Hannah Arendt intensiv wahrgenommen und beschrieben hat, und die Entwicklung, die wir heute teilweise sehen – zwar mit anderen technischen Möglichkeiten, anderen gesellschaftlichen Herausforderungen – in vielen Punkten vergleichbar. Das sind Themen, die wir versuchen, mit aufzubereiten, um sie zum einen in einen historischen Kontext zu setzen, zum anderen aber auch eine Übersetzungsleistung zu schaffen. Was heißt das für heute, für unser Handeln, für unsere Debatten und Diskussionen? Da spielen die Fragen von Medienkonsum eine sehr große Rolle.
Um etwas von Hannah Arendt aufzugreifen – ein Podium der Hannah-Arendt-Tage fragt nach dem Thema „Starke Männer braucht das Land? Frauen zwischen Aufbruch und Rollback“. Wie stehen Sie persönlich zu diesem Thema?
Wir sehen ein starkes internationales Rollback bei der Frage von Geschlechterrollen. Das ist schon irritierend, wie schnell das geht. Aus meiner Sicht ist das besorgniserregend, weil die Frage von Geschlechtergerechtigkeit in vielen Ländern, auch in Deutschland, eine Grundrechtsfrage ist. Welche Rechte haben Frauen über ihren Körper, wie steht es um die Teilhaberechte von Minderheiten, geschlechtlichen Identitäten? Das ist in Deutschland beispielhaft mit Positionierungen des Bundesverfassungsgerichts ausgeurteilt worden. Das sicherzustellen, auch Rechte zu gewährleisten – sie nicht nur auf dem Papier zu haben, sondern auch in der Realität – das ist wichtig. Und genau das wird infrage gestellt. Wir erleben zurzeit in den USA, wie schnell eine Regierung Minderheitenrechte beschränken oder abschaffen kann und wie stark die gesellschaftliche Akzeptanz dafür ist. Gezielte Desinformationen und entfachte Emotionen spielen dabei eine große Rolle und werden bewusst zur Steuerung der Geschlechterordnung eingesetzt. Ich glaube, das ist ein gutes Podium, eine gute Möglichkeit, diese Punkte gemeinsam im Rahmen der Hannah-Arendt-Tage zu beleuchten.
Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um Frauen stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubinden und eine Gleichberechtigung sicherzustellen?
Das ist eine fortwährende Diskussion. Und wir erleben, wenn man sich den Bundestag anschaut, dass der Anteil von Frauen im Bundestag wieder geringer wird. Wo er nicht geringer wird, zum Beispiel bei einigen Parteien, gibt es klare Regelungen. Die Frage von Quoten wird aber nach wie vor kritisch diskutiert. Ich halte das für notwendig, um die Strukturen zu durchbrechen. Wir merken das, wenn man sich Strukturen anschaut – in Parteien oder in vielen anderen Organisationen –, dass festgefahrene Strukturen immer bedeuten, dass vor allem Männer, die fest verankert sind, die die Machtposition haben, häufig nicht bereit sind, diese aufzugeben, und oftmals die Positionen gleichsam weitervererben an weitere, nachfolgende Männer. Das ist meine Erfahrung nach den bisherigen Beobachtungen. Diese Strukturen muss man durchbrechen. Man braucht klare Vorgaben, um dies zu tun – in der Wirtschaft, in der Politik und in anderen gesellschaftlichen Feldern. Sonst funktioniert das nicht. Reine Lippenbekenntnisse führen dazu, dass es symbolhaft einzelne Personen gibt, die gezeigt werden. Damit wird suggeriert: Wir machen etwas. Das gesamte Bild in all diesen unterschiedlichen Lebensbereichen – Wirtschaft, Politik, Gesellschaft – ist mit Blick auf die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen ein sehr desolates, aus meiner Sicht.
Wie regeln Sie, wenn Gruppen oder Personen die Demokratie in Hannover diskreditieren oder aktiv angreifen?
Was ich sehr gut finde, ist, dass nicht nur ich persönlich gefragt bin, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Reaktion ist, die gezeigt werden muss. Ich kann mich als Oberbürgermeister ein Stück weit darauf stützen, dass die Stadtgesellschaft bereit ist, mitzugehen. Beim Thema Demokratie oder bei demokratischen Fragestellungen gibt es sehr starkes Engagement in und aus der Stadtgesellschaft. In Hannover hatten wir zum Thema Migration eine der größten Demonstrationen deutschlandweit: vierzigtausend Menschen, die damals am Opernplatz zu unterschiedlichen Anlässen waren. Menschen, die schnell Gesicht zeigen, Institutionen, die hier vor Ort engagiert sind. Deshalb merken wir, dass sich Hannover von anderen Städten in der Art und Weise, wie Position bezogen wird, teilweise unterscheidet. Das ist für mich sehr wichtig. Denn ich will Oberbürgermeister einer Stadt sein, wo das der Fall ist, wo die Mehrheit der Menschen diese Haltung hat. Dafür kann ich mehr Einsatz zeigen, werde auch bundesweit gehört zu den verschiedensten Anlässen.
Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Hannover, um allen Menschen, insbesondere jungen Leuten oder Menschen mit Migrationshintergrund, politische Teilhabe zu ermöglichen?
Es gibt unterschiedliche Formate. Wir haben den WIR 2.0-Prozess. Es gibt den lokalen Integrationsplan, so hieß der früher. Der ist zehn, zwölf Jahre alt. Wir haben den geupdatet, auf einen neuen Stand durch eine große Beteiligung gebracht. Da sind viele junge Initiativen und Menschen mit daran beteiligt worden. Dieser Plan hat sich namentlich verändert – vom lokalen Integrationsplan zu einem Teilhabeplan. Das Feedback vieler junger Menschen war: „Ich will mich nicht integrieren. Das ist meine Stadt. Ich lebe hier. Wo soll ich mich integrieren?“ Mir geht es darum, Teilhabe sicherzustellen. Und das ist spürbar, nicht nur beim Namen, weil es nicht mehr LIP heißt, lokaler Integrationsplan, sondern WIR 2.0. Es verfolgt einen anderen Ansatz. Das merkt man inhaltlich. Dort sind weitere Instrumente vorgesehen, um eine Beteiligung von jungen Menschen sicherzustellen. Wir haben in den unterschiedlichsten Stadtentwicklungsprojekten immer eine Jugendbeteiligung – bei den Fragen: Wie soll die Innenstadt aussehen? Wie sollen Verkehr und Mobilität sich verändern? Was sind die Erwartungen für eine Stadt von morgen – im Bereich der Bildungsinfrastruktur, Schulen, Kitas und darüber hinaus? Wir machen uns auf den Weg, kinderfreundliche Kommune zu werden. Das ist das Label. Es hat zum Inhalt, dass wir bei Kindern, insbesondere bei kleineren Kindern, ansetzen wollen, um ein demokratisches Grundverständnis zu entwickeln und Beteiligung sicherzustellen.
Wie informieren Sie Bürgerinnen und Bürger transparent über Entscheidungen und Vorgänge im Rathaus?
Das Rathaus ist ein offenes Haus. Ihr habt das beim Hereingehen gesehen. Es ist nicht wie im Bundestag. Dort ist es fast wie am Flughafen, wo man gecheckt und kontrolliert wird. Hier können alle Menschen jederzeit herein- und herausgehen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil wir wollen, dass keine Distanz entsteht oder keine Schwelle, über die man gehen muss, sondern dass hier die Offenheit besteht. Das ist auch der Fall für die Sitzungen, die öffentlich sind. Die Drucksachen sind alle einsehbar und sichtbar. Man kann alles nachverfolgen, online oder vorbeischauen und Einblick nehmen. Wir haben selber eine Informationsplattform über Hannover.de. Wir kommunizieren über die sozialen Netzwerke. Wir kommunizieren über die Medien. Ich habe Bürgersprechstunden, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, mit mir ins Gespräch zu kommen, verschiedenste Formate der Beteiligung. Wir haben zu den großen Stadtprojekten sehr große Beteiligungsformate gemacht – wie Innenstadt, Nördlicher Hauptbahnhof –, dass Areale weiterentwickelt werden, auch größere Themen wie Wärmewende. Das wird mit Beteiligung der Menschen oder der Betroffenen umgesetzt. Das ist für uns ein großer Anspruch. Darüber hinaus gibt es rechtliche Formate von Beteiligung. Ich mache Einwohner*innenversammlungen in den unterschiedlichsten Stadtbezirken. Das ist ein guter Anlass, um ins Gespräch zu kommen und selber zu informieren.
Als Abschlussfrage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wie können wir als Gesellschaft Macht demokratischer, gerechter und auch gewaltfreier gestalten?
Was ich mir für Hannover wünschen würde, ist – ich habe es gerade beschrieben –, dass wir eine solidarische Grundhaltung haben, dass sie weiter Bestand hat und von uns allen unterstützt wird. Ich glaube, dies ist die Grundlage für ein demokratisches Miteinander und für die beschriebenen Herausforderungen mit Blick auf Strukturen, Checks and Balances, eine ausbalancierte Macht und Gewaltenteilung. Das ist auf der kommunalen Ebene wichtig. Die Städte sind die Orte, wo das das erste Mal real wird. Für viele Menschen ist Demokratie das Rathaus und das, was vor Ort passiert. Und das hat eine Wirkung in die Landtage und in den Bundestag hinein.
Herr Onay, vielen Dank für das Interview.